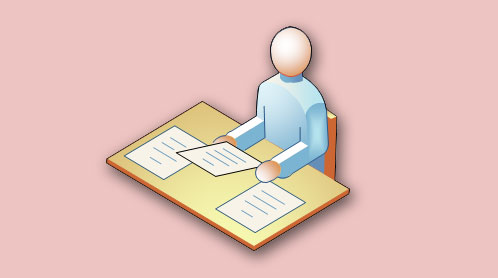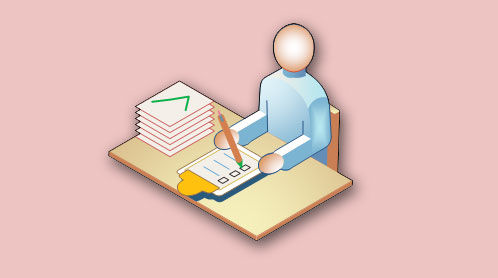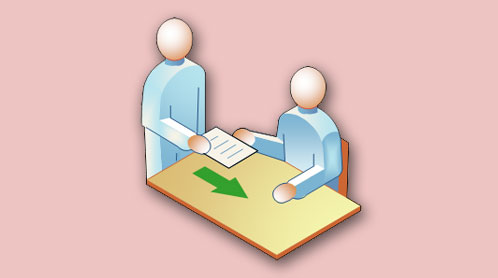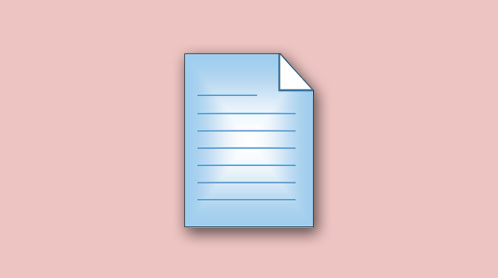Enteignungsverfahren
Was ist eine Enteignung?
Das Recht auf Eigentum wird durch Artikel 14 Absatz 1 des Grundgesetzes (GG) verfassungsrechtlich geschützt. Allerdings heißt es in Artikel 14 Absatz 2 des Grundgesetzes weiter: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Allgemeinwohl dienen.". Mit diesem Wortlaut wird dem Eigentum zugleich auch eine soziale Verpflichtung zugewiesen.
Bei der Umsetzung von dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Infrastrukturmaßnahmen (zum Beispiel Straßen-, Schienenbaumaßnahmen, städtebauliche Maßnahmen) werden oftmals Grundstücke oder Rechte an Grundstücken benötigt, die von den Maßnahmeträgern üblicherweise im Rahmen freiwilliger Vereinbarungen erworben werden sollen. Wenn jedoch eine einvernehmliche Regelung nicht möglich ist, könnte die geplante Maßnahme - zum Nachteil des Allgemeinwohls - nicht umgesetzt werden.
Um dennoch im Interesse der Allgemeinheit eine solche Maßnahme nicht scheitern zu lassen, wird mit Artikel 14 Absatz 3 des Grundgesetzes unter bestimmten Voraussetzungen der Eingriff in das Grundrecht Eigentum zugelassen:
- Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig (Artikel 14 Absatz 3 Satz 1 GG).
- Sie darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das zugleich Art und Ausmaß der Entschädigung regelt (Artikel 14 Absatz 3 Satz 2 GG).
- Dabei ist die Entschädigung unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen (Artikel 14 Absatz 3 Satz 3 GG).
Dem entsprechend sehen verschiedene Gesetze die Möglichkeit einer Enteignung vor, wenn:
- das Wohl der Allgemeinheit es erfordert,
- der Zweck der Enteignung anders nicht erreicht werden kann und
- ein ernsthaftes schriftliches Kaufangebot abgelehnt wurde.
Durch eine Enteignung wird in das Grundrecht Eigentum eingegriffen.
Enteignung = Entzug oder Belastung des Eigentums an einem Grundstück
Das Recht auf Eigentum wird durch Artikel 14 Absatz 1 des Grundgesetzes (GG) verfassungsrechtlich geschützt. Allerdings heißt es in Artikel 14 Absatz 2 des Grundgesetzes weiter: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Allgemeinwohl dienen.". Mit diesem Wortlaut wird dem Eigentum zugleich auch eine soziale Verpflichtung zugewiesen.
Bei der Umsetzung von dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Infrastrukturmaßnahmen (zum Beispiel Straßen-, Schienenbaumaßnahmen, städtebauliche Maßnahmen) werden oftmals Grundstücke oder Rechte an Grundstücken benötigt, die von den Maßnahmeträgern üblicherweise im Rahmen freiwilliger Vereinbarungen erworben werden sollen. Wenn jedoch eine einvernehmliche Regelung nicht möglich ist, könnte die geplante Maßnahme - zum Nachteil des Allgemeinwohls - nicht umgesetzt werden.
Um dennoch im Interesse der Allgemeinheit eine solche Maßnahme nicht scheitern zu lassen, wird mit Artikel 14 Absatz 3 des Grundgesetzes unter bestimmten Voraussetzungen der Eingriff in das Grundrecht Eigentum zugelassen:
- Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig (Artikel 14 Absatz 3 Satz 1 GG).
- Sie darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das zugleich Art und Ausmaß der Entschädigung regelt (Artikel 14 Absatz 3 Satz 2 GG).
- Dabei ist die Entschädigung unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen (Artikel 14 Absatz 3 Satz 3 GG).
Dem entsprechend sehen verschiedene Gesetze die Möglichkeit einer Enteignung vor, wenn:
- das Wohl der Allgemeinheit es erfordert,
- der Zweck der Enteignung anders nicht erreicht werden kann und
- ein ernsthaftes schriftliches Kaufangebot abgelehnt wurde.
Durch eine Enteignung wird in das Grundrecht Eigentum eingegriffen.
Enteignung = Entzug oder Belastung des Eigentums an einem Grundstück
Wer sind die Beteiligten?
Wer Beteiligter im Enteignungsverfahren ist, regeln
- § 21 Enteignungsgesetz des Landes Brandenburg (EntGBbg) beziehungsweise
- § 106 Baugesetzbuch (BauGB).
Beteiligte sind insbesondere
- der Antragsteller (in der Regel der Maßnahmeträger),
- der Eigentümer,
- der Inhaber eines im Grundbuch eingetragenen Rechts,
- der Inhaber eines nicht im Grundbuch eingetragenen Rechts, wenn er sein Recht bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung anmeldet,
- die Gemeinde.
Wer Beteiligter im Enteignungsverfahren ist, regeln
- § 21 Enteignungsgesetz des Landes Brandenburg (EntGBbg) beziehungsweise
- § 106 Baugesetzbuch (BauGB).
Beteiligte sind insbesondere
- der Antragsteller (in der Regel der Maßnahmeträger),
- der Eigentümer,
- der Inhaber eines im Grundbuch eingetragenen Rechts,
- der Inhaber eines nicht im Grundbuch eingetragenen Rechts, wenn er sein Recht bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung anmeldet,
- die Gemeinde.
Was regelt ein Enteignungsbeschluss?
Wird einem Enteignungsantrag stattgegeben, bestimmen
- § 30 des Enteignungsgesetzes des Landes Brandenburg (EntGBbg) beziehungsweis
- § 113 des Baugesetzbuches (BauGB)
die regelmäßigen Anforderungen an den Inhalt des Enteignungsbeschlusses.
Der Enteignungsbeschluss bezeichnet insbesondere
- die von der Enteignung Betroffenen, den Enteignungsbegünstigten und die sonstigen Beteiligten,
- den Enteignungszweck und die Frist, innerhalb der das Grundstück zu dem vorgesehenen Zweck zu verwenden ist,
- die Eigentums- und sonstigen Rechtsverhältnisse vor und nach der Enteignung,
- Art und Höhe der Entschädigung mit der Angabe, von wem und an wen sie zu leisten ist.
Der Enteignungsbeschluss begründet - ebenso wie eine Einigung vor der Enteignungsbehörde - den Anspruch des Betroffenen auf Zahlung der Enteignungsentschädigung und ist insofern ein vollstreckbarer Titel.
Der Enteignungsbeschluss allein führt jedoch noch nicht zu einer Änderung der Rechtsverhältnisse an einem Grundstück. Er bildet nur die rechtliche Grundlage dafür. Zur Begründung der neuen Rechtsverhältnisse bedarf es erst der Ausführung des Enteignungsbeschlusses aufgrund der Ausführungsanordnung, die durch die Enteignungsbehörde erlassen wird.
Weiterführene Links:
Wird einem Enteignungsantrag stattgegeben, bestimmen
- § 30 des Enteignungsgesetzes des Landes Brandenburg (EntGBbg) beziehungsweis
- § 113 des Baugesetzbuches (BauGB)
die regelmäßigen Anforderungen an den Inhalt des Enteignungsbeschlusses.
Der Enteignungsbeschluss bezeichnet insbesondere
- die von der Enteignung Betroffenen, den Enteignungsbegünstigten und die sonstigen Beteiligten,
- den Enteignungszweck und die Frist, innerhalb der das Grundstück zu dem vorgesehenen Zweck zu verwenden ist,
- die Eigentums- und sonstigen Rechtsverhältnisse vor und nach der Enteignung,
- Art und Höhe der Entschädigung mit der Angabe, von wem und an wen sie zu leisten ist.
Der Enteignungsbeschluss begründet - ebenso wie eine Einigung vor der Enteignungsbehörde - den Anspruch des Betroffenen auf Zahlung der Enteignungsentschädigung und ist insofern ein vollstreckbarer Titel.
Der Enteignungsbeschluss allein führt jedoch noch nicht zu einer Änderung der Rechtsverhältnisse an einem Grundstück. Er bildet nur die rechtliche Grundlage dafür. Zur Begründung der neuen Rechtsverhältnisse bedarf es erst der Ausführung des Enteignungsbeschlusses aufgrund der Ausführungsanordnung, die durch die Enteignungsbehörde erlassen wird.
Weiterführene Links:
Anmerkungen zur Möglichkeit der Vorabentscheidung
Gem. § 29 Abs. 2 S. 1 EntGBbg bzw. § 112 Abs. 2 S. 1 BauGB können die Verfahrensbeteiligten bei der Enteignungsbehörde schriftlich oder zur Niederschrift die Vorabentscheidung beantragen. „Vorab“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass zunächst gesondert über die Rechtmäßigkeit der Enteignung - also dem Grunde nach - entschieden wird. Sofern dem Antrag stattgegeben wird, erhält der Betroffene eine Vorauszahlung in Höhe der zu erwarteten Entschädigung für seinen Rechtsverlust (z.B. Übergang oder Belastung seines Eigentums). Erst im Anschluss folgt die endgültige Ermittlung und Festsetzung der genauen Entschädigungshöhe. Der ansonsten vorgeschriebene übliche Verfahrensablauf - Entscheidung über Enteignung und Entschädigung in einem Zug - wird dadurch in zwei Beschlüsse aufgetrennt.
Hintergrund dieser Regelung ist der Beschleunigungsgrundsatz. Nicht in jedem Fall ist eine vorzeitige Besitzeinweisung gerechtfertigt. Die Durchführung eines Bauvorhabens soll dennoch nicht durch Streitigkeiten über die Entschädigung unnötig verzögert werden. Der Gesetzgeber geht dabei davon aus, dass die Frage der Berechnung der Entschädigungshöhe regelmäßig mehr Zeit in Anspruch nimmt, als die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der Enteignung dem Grunde nach.
Ob ein Antrag auf Vorabentscheidung tatsächlich eine Beschleunigung bewirkt, hängt stets vom konkreten Sachverhalt ab. Seitens des Antragstellers sollte genau geprüft werden, ob die Vorabentscheidung das geeignete Mittel für das jeweilige Begehren darstellt. Trotz des Beschleunigungsgedankens verschafft die Vorabentscheidung u.U. keinen schnelleren bzw. rechtzeitigen Besitz an den benötigten Flächen. So ist bspw. zu beachten, dass nicht schon der Vorabentscheidungsbeschluss, sondern stets erst die Ausführungsanordnung die Eigentumsverhältnisse - verbunden mit der Möglichkeit der Inbesitznahme - neu regelt. Den Enteignungsbetroffenen steht gegen beide Verwaltungsakte der Rechtsweg offen. Werden nur Teilflächen eines Flurstückes benötigt, bedarf es vor Erlass der Ausführungsanordnung zusätzlich einer Vermessung und Zerlegung sowie eines konkretisierenden Nachtragsbeschlusses.
Auch ohne derartige Hindernisse stellt die Vorabentscheidung kein Eilverfahren dar und sollte keinesfalls als Ersatz für eine vorzeitige Besitzeinweisung mit ihren kurzen Fristen und wenigen Voraussetzungen gesehen werden.
Gem. § 29 Abs. 2 S. 1 EntGBbg bzw. § 112 Abs. 2 S. 1 BauGB können die Verfahrensbeteiligten bei der Enteignungsbehörde schriftlich oder zur Niederschrift die Vorabentscheidung beantragen. „Vorab“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass zunächst gesondert über die Rechtmäßigkeit der Enteignung - also dem Grunde nach - entschieden wird. Sofern dem Antrag stattgegeben wird, erhält der Betroffene eine Vorauszahlung in Höhe der zu erwarteten Entschädigung für seinen Rechtsverlust (z.B. Übergang oder Belastung seines Eigentums). Erst im Anschluss folgt die endgültige Ermittlung und Festsetzung der genauen Entschädigungshöhe. Der ansonsten vorgeschriebene übliche Verfahrensablauf - Entscheidung über Enteignung und Entschädigung in einem Zug - wird dadurch in zwei Beschlüsse aufgetrennt.
Hintergrund dieser Regelung ist der Beschleunigungsgrundsatz. Nicht in jedem Fall ist eine vorzeitige Besitzeinweisung gerechtfertigt. Die Durchführung eines Bauvorhabens soll dennoch nicht durch Streitigkeiten über die Entschädigung unnötig verzögert werden. Der Gesetzgeber geht dabei davon aus, dass die Frage der Berechnung der Entschädigungshöhe regelmäßig mehr Zeit in Anspruch nimmt, als die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der Enteignung dem Grunde nach.
Ob ein Antrag auf Vorabentscheidung tatsächlich eine Beschleunigung bewirkt, hängt stets vom konkreten Sachverhalt ab. Seitens des Antragstellers sollte genau geprüft werden, ob die Vorabentscheidung das geeignete Mittel für das jeweilige Begehren darstellt. Trotz des Beschleunigungsgedankens verschafft die Vorabentscheidung u.U. keinen schnelleren bzw. rechtzeitigen Besitz an den benötigten Flächen. So ist bspw. zu beachten, dass nicht schon der Vorabentscheidungsbeschluss, sondern stets erst die Ausführungsanordnung die Eigentumsverhältnisse - verbunden mit der Möglichkeit der Inbesitznahme - neu regelt. Den Enteignungsbetroffenen steht gegen beide Verwaltungsakte der Rechtsweg offen. Werden nur Teilflächen eines Flurstückes benötigt, bedarf es vor Erlass der Ausführungsanordnung zusätzlich einer Vermessung und Zerlegung sowie eines konkretisierenden Nachtragsbeschlusses.
Auch ohne derartige Hindernisse stellt die Vorabentscheidung kein Eilverfahren dar und sollte keinesfalls als Ersatz für eine vorzeitige Besitzeinweisung mit ihren kurzen Fristen und wenigen Voraussetzungen gesehen werden.
Ist die Enteignung vermeidbar?
Streitet der Betroffene mit dem Maßnahmeträger nur noch über die Höhe der Entschädigung, so kann er den Übergang des Eigentums oder eines anderen Rechts auf den Maßnahmeträger außerhalb des Enteignungsverfahrens - zum Beispiel durch einen notariellen Kaufvertrag oder eine Dienstbarkeitsbewilligung - vereinbaren.
Dabei ist es üblich, sich im Vertrag alle strittigen Entschädigungsansprüche vorzubehalten. Außerdem sollte sich der Maßnahmeträger im Vertrag verpflichten, bei der Enteignungsbehörde umgehend die Durchführung eines Entschädigungsfestsetzungsverfahrens zu beantragen.
Weiterführende Links:
Streitet der Betroffene mit dem Maßnahmeträger nur noch über die Höhe der Entschädigung, so kann er den Übergang des Eigentums oder eines anderen Rechts auf den Maßnahmeträger außerhalb des Enteignungsverfahrens - zum Beispiel durch einen notariellen Kaufvertrag oder eine Dienstbarkeitsbewilligung - vereinbaren.
Dabei ist es üblich, sich im Vertrag alle strittigen Entschädigungsansprüche vorzubehalten. Außerdem sollte sich der Maßnahmeträger im Vertrag verpflichten, bei der Enteignungsbehörde umgehend die Durchführung eines Entschädigungsfestsetzungsverfahrens zu beantragen.
Weiterführende Links:
Wie läuft das Verfahren ab?
Die Enteignungsbehörde wird erst auf Antrag tätig. Die Beantragung eines Enteignungsverfahrens bei der Enteignungsbehörde ist stets das letzte Mittel, zu dem der Maßnahmeträger erst greifen darf, wenn alle Bemühungen um eine einvernehmliche Regelung gescheitert sind. Zuvor hat der Maßnahmeträger mit dem betroffenen Eigentümer zu verhandeln und sich dabei intensiv um eine Einigung zu bemühen.
Das Enteignungsverfahren ist ein förmliches Verfahren und in den §§ 24 ff. des Enteignungsgesetzes des Landes Brandenburg (EntGBbg) sowie in den §§ 107 ff. des Baugesetzbuches (BauGB) geregelt.
In diesem Verfahren nimmt die Enteignungsbehörde eine unparteiische Rolle zwischen den Beteiligten ein, ähnlich wie ein Gericht.
Eine Entscheidung wird durch die Enteignungsbehörde immer erst dann getroffen, wenn die Beteiligten sich nicht einigen können.
Die Enteignungsbehörde wird erst auf Antrag tätig. Die Beantragung eines Enteignungsverfahrens bei der Enteignungsbehörde ist stets das letzte Mittel, zu dem der Maßnahmeträger erst greifen darf, wenn alle Bemühungen um eine einvernehmliche Regelung gescheitert sind. Zuvor hat der Maßnahmeträger mit dem betroffenen Eigentümer zu verhandeln und sich dabei intensiv um eine Einigung zu bemühen.
Das Enteignungsverfahren ist ein förmliches Verfahren und in den §§ 24 ff. des Enteignungsgesetzes des Landes Brandenburg (EntGBbg) sowie in den §§ 107 ff. des Baugesetzbuches (BauGB) geregelt.
In diesem Verfahren nimmt die Enteignungsbehörde eine unparteiische Rolle zwischen den Beteiligten ein, ähnlich wie ein Gericht.
Eine Entscheidung wird durch die Enteignungsbehörde immer erst dann getroffen, wenn die Beteiligten sich nicht einigen können.