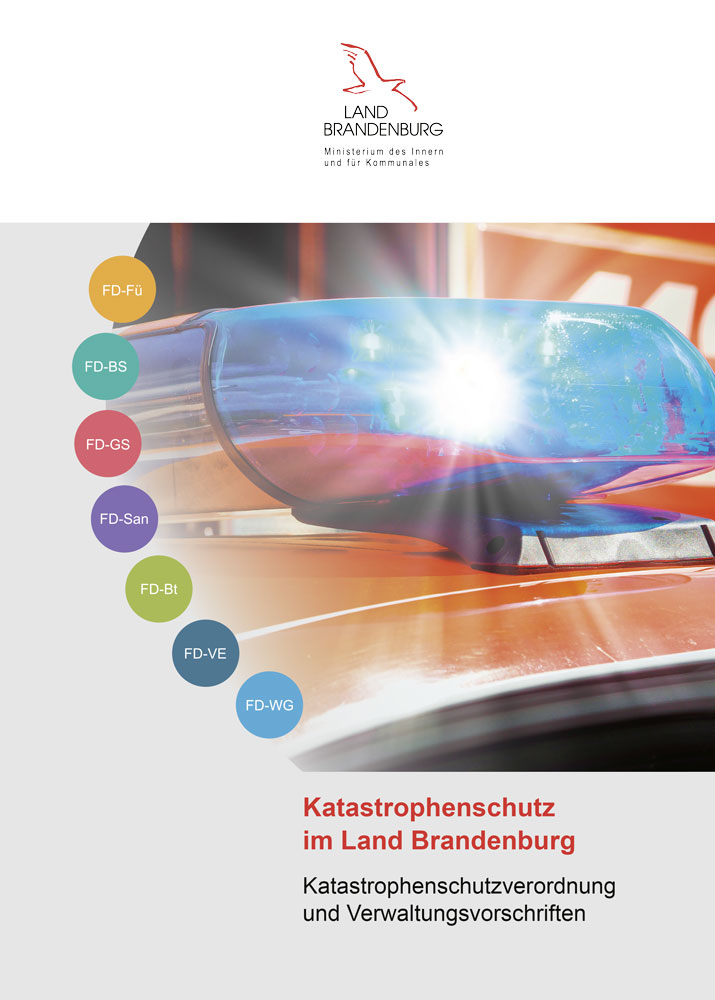Organisation des Katastrophenschutzes
Hilfeleistungssystem
Der Katastrophenschutz steht aufgrund der veränderten Sicherheits- und Gefahrenlage vor neuen Herausforderungen. Diesen begegnet das Brandenburg mit einem starken Hilfeleistungssystem, das sich durch das Zusammenwirken kommunaler und staatlicher Aufgabenträger sowie der zahlreichen ehren- und hauptamtlichen Einsatzkräfte der öffentlichen Feuerwehren, der im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen und des Technischen Hilfswerks auszeichnet.
Der Katastrophenschutz steht aufgrund der veränderten Sicherheits- und Gefahrenlage vor neuen Herausforderungen. Diesen begegnet das Brandenburg mit einem starken Hilfeleistungssystem, das sich durch das Zusammenwirken kommunaler und staatlicher Aufgabenträger sowie der zahlreichen ehren- und hauptamtlichen Einsatzkräfte der öffentlichen Feuerwehren, der im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen und des Technischen Hilfswerks auszeichnet.
Gefahrenschwerpunkte
Die Gefahren bzw. Gefahrenlagen mit denen sich das Land Brandenburg auseinandersetzen muss, sind vielfältig. Dies haben nicht nur die Erfahrungen der vergangenen Jahre gezeigt, sondern wird auch durch die regelmäßig vom Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg (MIK) erstellten Gefahren- und Risikoanalysen deutlich.
Neben den inzwischen regelmäßig in den Sommermonaten auftretenden Vegetations- bzw. Waldbränden sind vor allem Naturkatastrophen, wie zum Beispiel Trocken- und Dürreperioden, Hochwasser- oder Starkregenereignisse ernstzunehmende Gefahren. Darüber hinaus haben die vergangenen Jahre bestätigt, dass auch pandemische Lagen, Tierseuchen oder ein flächendeckender, langanhaltender Stromausfall sowie zunehmend Cyberangriffe in die Gefahren- und Risikoanalysen einzubeziehen sind.
Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat deutlich aufgezeigt, dass der Bereich des Bevölkerungsschutzes und insbesondere des Krisenmanagements weiteren Herausforderungen ausgesetzt ist. So sind Maßnahmen für den Spannungs- und Verteidigungsfall ebenso zu betrachten wie Liefer- und Versorgungsengpässe, terroristische Angriffe und der Ausfall oder die systemkritische Beeinträchtigung kritischer Infrastrukturen (KRITIS).
Die Gefahren bzw. Gefahrenlagen mit denen sich das Land Brandenburg auseinandersetzen muss, sind vielfältig. Dies haben nicht nur die Erfahrungen der vergangenen Jahre gezeigt, sondern wird auch durch die regelmäßig vom Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg (MIK) erstellten Gefahren- und Risikoanalysen deutlich.
Neben den inzwischen regelmäßig in den Sommermonaten auftretenden Vegetations- bzw. Waldbränden sind vor allem Naturkatastrophen, wie zum Beispiel Trocken- und Dürreperioden, Hochwasser- oder Starkregenereignisse ernstzunehmende Gefahren. Darüber hinaus haben die vergangenen Jahre bestätigt, dass auch pandemische Lagen, Tierseuchen oder ein flächendeckender, langanhaltender Stromausfall sowie zunehmend Cyberangriffe in die Gefahren- und Risikoanalysen einzubeziehen sind.
Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat deutlich aufgezeigt, dass der Bereich des Bevölkerungsschutzes und insbesondere des Krisenmanagements weiteren Herausforderungen ausgesetzt ist. So sind Maßnahmen für den Spannungs- und Verteidigungsfall ebenso zu betrachten wie Liefer- und Versorgungsengpässe, terroristische Angriffe und der Ausfall oder die systemkritische Beeinträchtigung kritischer Infrastrukturen (KRITIS).
Gesetzliche Bestimmungen
Das Land Brandenburg ist nach dem Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) Träger der zentralen Aufgaben im Brandschutz, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes. Demnach obliegt es dem Land, u. a. die übrigen Aufgabenträger bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Die Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Katastrophenschutzes werden von den kreisfreien Städten und Landkreisen als untere Katastrophenschutzbehörden wahrgenommen. Das für den Katastrophenschutz zuständige Ministerium nimmt als oberste Katastrophenschutzbehörde die Sonderaufsicht wahr und übernimmt die Koordination der verschiedenen Akteure auf Landesebene.
Das Land Brandenburg ist nach dem Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) Träger der zentralen Aufgaben im Brandschutz, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes. Demnach obliegt es dem Land, u. a. die übrigen Aufgabenträger bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Die Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Katastrophenschutzes werden von den kreisfreien Städten und Landkreisen als untere Katastrophenschutzbehörden wahrgenommen. Das für den Katastrophenschutz zuständige Ministerium nimmt als oberste Katastrophenschutzbehörde die Sonderaufsicht wahr und übernimmt die Koordination der verschiedenen Akteure auf Landesebene.
Ziel des Katastrophenschutzes...
Ziel des Katastrophenschutzes ist die Gewährleistung von Maßnahmen in einem integrierten Hilfeleistungssystem zur Vorbereitung der Bekämpfung von Großschadensereignissen und Katastrophen (vorbeugender Katastrophenschutz) und zur Abwehr sowie Beseitigung der Folgen von Großschadensereignissen und Katastrophen (abwehrender Katastrophenschutz).
Katastrophen sind insbesondere Naturereignisse oder durch Mensch oder Technik verursachte Ereignisse, die eine Beeinträchtigung oder unmittelbare Gefährdung von Leben oder Gesundheit einer Vielzahl von Menschen, erheblicher Sachwerte, lebensnotwendiger Unterkünfte oder der Versorgung der Bevölkerung bedeuten und dabei zugleich erhebliche Störungen oder unmittelbare Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung verursachen, durch Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes und trotz Nachbarschaftshilfe nicht in angemessener Zeit beseitigt werden können und den Einsatz der Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes unter einheitlicher Führung erfordern. Die Feststellung einer Katastrophe kann dabei nur im konkreten Einzelfall unter Gesamtwürdigung aller tatsächlichen Gegebenheiten erfolgen.
Großschadensereignisse sind Geschehen, die eine große Anzahl von Menschen oder erhebliche Sachwerte gefährden und zu deren wirksamen Bekämpfung die Kräfte und Mittel der Träger des örtlichen Brandschutzes und des Rettungsdienstes nicht ausreichen, sondern überörtliche oder zentrale Führung und Einsatzmittel erforderlich sind.
Ziel des Katastrophenschutzes ist die Gewährleistung von Maßnahmen in einem integrierten Hilfeleistungssystem zur Vorbereitung der Bekämpfung von Großschadensereignissen und Katastrophen (vorbeugender Katastrophenschutz) und zur Abwehr sowie Beseitigung der Folgen von Großschadensereignissen und Katastrophen (abwehrender Katastrophenschutz).
Katastrophen sind insbesondere Naturereignisse oder durch Mensch oder Technik verursachte Ereignisse, die eine Beeinträchtigung oder unmittelbare Gefährdung von Leben oder Gesundheit einer Vielzahl von Menschen, erheblicher Sachwerte, lebensnotwendiger Unterkünfte oder der Versorgung der Bevölkerung bedeuten und dabei zugleich erhebliche Störungen oder unmittelbare Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung verursachen, durch Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes und trotz Nachbarschaftshilfe nicht in angemessener Zeit beseitigt werden können und den Einsatz der Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes unter einheitlicher Führung erfordern. Die Feststellung einer Katastrophe kann dabei nur im konkreten Einzelfall unter Gesamtwürdigung aller tatsächlichen Gegebenheiten erfolgen.
Großschadensereignisse sind Geschehen, die eine große Anzahl von Menschen oder erhebliche Sachwerte gefährden und zu deren wirksamen Bekämpfung die Kräfte und Mittel der Träger des örtlichen Brandschutzes und des Rettungsdienstes nicht ausreichen, sondern überörtliche oder zentrale Führung und Einsatzmittel erforderlich sind.
Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes
Die Verantwortung für die Aufstellung und den Betrieb der Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes liegt bei den Landkreisen und kreisfreien Städten als untere Katastrophenschutzbehörden. Das Land Brandenburg übernimmt hierbei eine unterstützende Funktion.
Mit der „Verordnung über die Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes - Katastrophenschutzverordnung (KatSV)“ hat das Land Brandenburg die Organisation, die Mindeststärken von Personal und Technik sowie die Ausbildung und den Einsatz der Katastrophenschutzeinheiten verbindlich geregelt.
Diese verteilen sich auf die Fachdienste Führung, Brandschutz, Gefahrstoffschutz, Sanität, Betreuung, Versorgung und Bergung, Teilbereich Wassergefahren, die von den unteren Katastrophenschutzbehörden auf der Grundlage ihrer Gefahren- und Risikoanalyse durch folgende Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes untersetzt und unterhalten werden: Katastrophenschutzleitungen (KatSL), Führungsstäbe (FüSt), Schnelleinsatzgruppen Führungsunterstützung (SEG Fü), Brandschutzeinheiten (BSE), Schnelleinsatzeinheiten Sanität (SEE San), Schnelleinsatzgruppen Betreuung (SEG Bt), Notfallseelsorge-/Kriseninterventionsteams (NFS/KIT), Schnelleinsatzgruppen Verpflegung (SEG V), Personenauskunftsstellen (PASt), Gefahrstoffeinheiten (GSE), Schnelleinsatzgruppen Wassergefahren (SEG-W), Schnelleinsatzeinheiten Versorgung Energie (SEE-VE) und Katastrophenschutzlager.
Des Weiteren werden die Fachdienste gemeinsam von den unteren Katastrophenschutzbereiches innerhalb eines Regionalleitstellenbereichs (https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/rlsv_2007) durch die Mobilen Führungsunterstützungs-Einheiten (MoFüstE), Hochleistungsfördersysteme (HFS), Technischen Züge (TZ), CBRN-Messleitkomponenten (CBRN-MLK), Medizinischen Task Forces (MTF) (https://www.bbk.bund.de/DE/Themen/Gesundheitlicher-Bevoelkerungsschutz/Sanitaetsdienst/MTF/mtf_node.html) (bestehend aus Führungsgruppe, Behandlungsbereitschaft, Patiententransportgruppe, Zug Dekontamination Verletzter und Logistik-Zug), Einheiten „Betreuungsplatz 300“ (BtP 300), Wassergefahren-Züge (WG-Z) als überregionale Einsatzkapazitäten vervollständigt.
Auf Landesebene wird der Katastrophenschutz durch das Einsatz-Nachsorge-Team (ENT) als Regieeinheit, das landeseigene Katastrophenschutzlager und weitere spezielle Ressourcen unterstützt.
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben setzen die unteren Katastrophenschutzbehörden neben den öffentlichen Feuerwehren die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen, wie den Arbeiter-Samariter-Bund, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter-Unfall-Hilfe und den Malteser Hilfsdienst ein. Darüber hinaus wirkt die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk mit ihren Einheiten nach Maßgabe des THW-Gesetzes mit. Die Aufgabenträger können die Einheiten auch selbst betreiben (Regieeinheiten).
Der Bund stellt dabei für Zwecke des Zivilschutzes (https://www.bbk.bund.de/DE/Das-BBK/Zivile-Verteidigung/Zivilschutz/zivilschutz_node.html) ergänzende Ausstattung zur Verfügung. Diese wird in die Katastrophenschutzeinheiten integriert und kann auch im Rahmen des örtlichen Brandschutzes und der örtlichen Hilfeleistung verwendet werden.
Die Verantwortung für die Aufstellung und den Betrieb der Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes liegt bei den Landkreisen und kreisfreien Städten als untere Katastrophenschutzbehörden. Das Land Brandenburg übernimmt hierbei eine unterstützende Funktion.
Mit der „Verordnung über die Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes - Katastrophenschutzverordnung (KatSV)“ hat das Land Brandenburg die Organisation, die Mindeststärken von Personal und Technik sowie die Ausbildung und den Einsatz der Katastrophenschutzeinheiten verbindlich geregelt.
Diese verteilen sich auf die Fachdienste Führung, Brandschutz, Gefahrstoffschutz, Sanität, Betreuung, Versorgung und Bergung, Teilbereich Wassergefahren, die von den unteren Katastrophenschutzbehörden auf der Grundlage ihrer Gefahren- und Risikoanalyse durch folgende Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes untersetzt und unterhalten werden: Katastrophenschutzleitungen (KatSL), Führungsstäbe (FüSt), Schnelleinsatzgruppen Führungsunterstützung (SEG Fü), Brandschutzeinheiten (BSE), Schnelleinsatzeinheiten Sanität (SEE San), Schnelleinsatzgruppen Betreuung (SEG Bt), Notfallseelsorge-/Kriseninterventionsteams (NFS/KIT), Schnelleinsatzgruppen Verpflegung (SEG V), Personenauskunftsstellen (PASt), Gefahrstoffeinheiten (GSE), Schnelleinsatzgruppen Wassergefahren (SEG-W), Schnelleinsatzeinheiten Versorgung Energie (SEE-VE) und Katastrophenschutzlager.
Des Weiteren werden die Fachdienste gemeinsam von den unteren Katastrophenschutzbereiches innerhalb eines Regionalleitstellenbereichs (https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/rlsv_2007) durch die Mobilen Führungsunterstützungs-Einheiten (MoFüstE), Hochleistungsfördersysteme (HFS), Technischen Züge (TZ), CBRN-Messleitkomponenten (CBRN-MLK), Medizinischen Task Forces (MTF) (https://www.bbk.bund.de/DE/Themen/Gesundheitlicher-Bevoelkerungsschutz/Sanitaetsdienst/MTF/mtf_node.html) (bestehend aus Führungsgruppe, Behandlungsbereitschaft, Patiententransportgruppe, Zug Dekontamination Verletzter und Logistik-Zug), Einheiten „Betreuungsplatz 300“ (BtP 300), Wassergefahren-Züge (WG-Z) als überregionale Einsatzkapazitäten vervollständigt.
Auf Landesebene wird der Katastrophenschutz durch das Einsatz-Nachsorge-Team (ENT) als Regieeinheit, das landeseigene Katastrophenschutzlager und weitere spezielle Ressourcen unterstützt.
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben setzen die unteren Katastrophenschutzbehörden neben den öffentlichen Feuerwehren die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen, wie den Arbeiter-Samariter-Bund, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter-Unfall-Hilfe und den Malteser Hilfsdienst ein. Darüber hinaus wirkt die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk mit ihren Einheiten nach Maßgabe des THW-Gesetzes mit. Die Aufgabenträger können die Einheiten auch selbst betreiben (Regieeinheiten).
Der Bund stellt dabei für Zwecke des Zivilschutzes (https://www.bbk.bund.de/DE/Das-BBK/Zivile-Verteidigung/Zivilschutz/zivilschutz_node.html) ergänzende Ausstattung zur Verfügung. Diese wird in die Katastrophenschutzeinheiten integriert und kann auch im Rahmen des örtlichen Brandschutzes und der örtlichen Hilfeleistung verwendet werden.
Ausbildung und Übungen
Die Aus- und Fortbildung der Katastrophenschutzeinheiten wird ständig weiterentwickelt, um auf neue Gefährdungen und Bedrohungen angemessen reagieren zu können. So wird auch die ergänzende Zivilschutzaus- und -fortbildung des Bundes in die Ausbildung der Katastrophenschutzeinheiten und -einrichtungen integriert.
Ein wesentlicher Bestandteil der Ausbildung sind regelmäßige Übungen, die unterschiedliche Szenarien simulieren und auch dazu dienen, die Einsatzbereitschaft zu überprüfen und aufrechtzuerhalten. Die Einheiten des Katastrophenschutzes führen folgende Übungen durch:
- Planübungen zur Schulung der Lagebeurteilung und Entscheidungsfindung anhand von Katastrophenschutzplänen und weiteren Einsatzunterlagen unter realistischen Bedingungen.
- Alarmierungsübungen zur Überprüfung der Alarmierungspläne und Alarmierungsbereitschaft der Einheiten.
- Stabsrahmenübungen zur Schulung und Überprüfung des Zusammenwirkens innerhalb der Katastrophenschutzleitung sowie des Katastrophenschutzstabes anhand eines angenommenen Schadensereignisses.
- Vollübungen zur Erprobung der Katastrophenschutzpläne, zur Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Katastrophenschutzeinheiten und -einrichtungen sowie ihres Zusammenwirkens untereinander und mit weiteren zur Mitwirkung verpflichteten Dritten. Im Rahmen der Vollübungen wird somit das gesamte Spektrum des Katastrophenschutzes erprobt, von der Einsatzkoordination bis hin zur effektiven Durchführung der Maßnahmen in der Praxis.
Die Aus- und Fortbildung der Katastrophenschutzeinheiten wird ständig weiterentwickelt, um auf neue Gefährdungen und Bedrohungen angemessen reagieren zu können. So wird auch die ergänzende Zivilschutzaus- und -fortbildung des Bundes in die Ausbildung der Katastrophenschutzeinheiten und -einrichtungen integriert.
Ein wesentlicher Bestandteil der Ausbildung sind regelmäßige Übungen, die unterschiedliche Szenarien simulieren und auch dazu dienen, die Einsatzbereitschaft zu überprüfen und aufrechtzuerhalten. Die Einheiten des Katastrophenschutzes führen folgende Übungen durch:
- Planübungen zur Schulung der Lagebeurteilung und Entscheidungsfindung anhand von Katastrophenschutzplänen und weiteren Einsatzunterlagen unter realistischen Bedingungen.
- Alarmierungsübungen zur Überprüfung der Alarmierungspläne und Alarmierungsbereitschaft der Einheiten.
- Stabsrahmenübungen zur Schulung und Überprüfung des Zusammenwirkens innerhalb der Katastrophenschutzleitung sowie des Katastrophenschutzstabes anhand eines angenommenen Schadensereignisses.
- Vollübungen zur Erprobung der Katastrophenschutzpläne, zur Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Katastrophenschutzeinheiten und -einrichtungen sowie ihres Zusammenwirkens untereinander und mit weiteren zur Mitwirkung verpflichteten Dritten. Im Rahmen der Vollübungen wird somit das gesamte Spektrum des Katastrophenschutzes erprobt, von der Einsatzkoordination bis hin zur effektiven Durchführung der Maßnahmen in der Praxis.